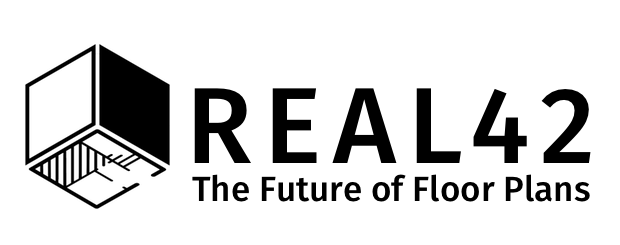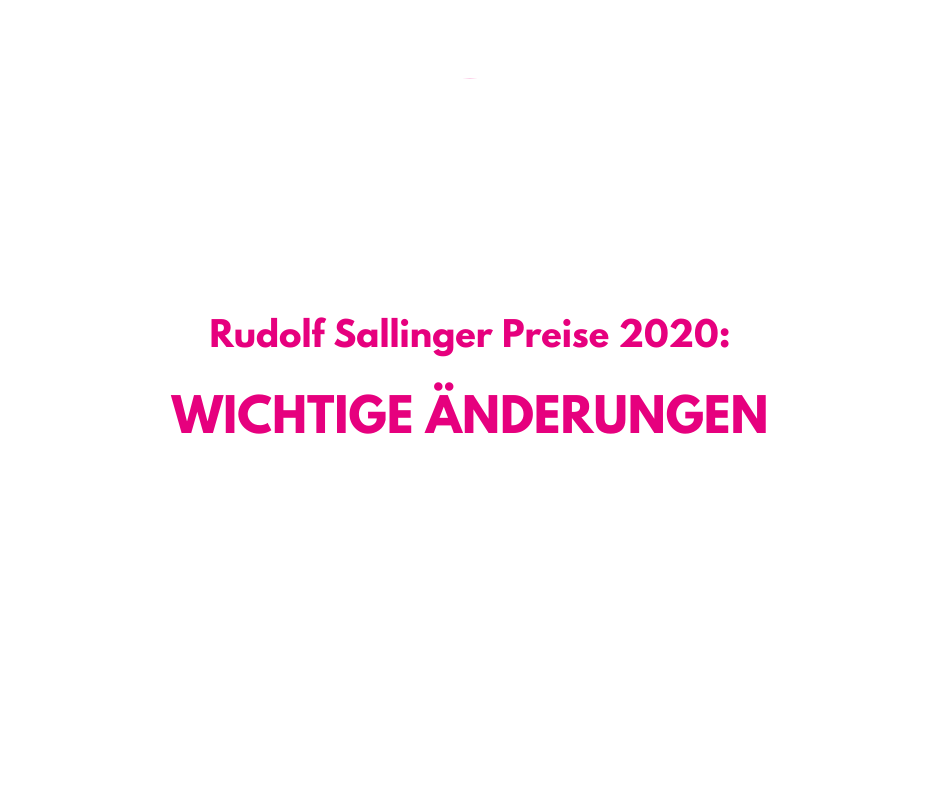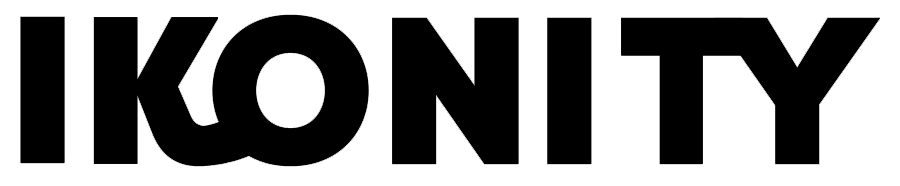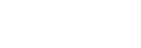Wie kann man die globale Ernährungssicherheit gewährleisten und gleichzeitig den CO2 Ausstoß nachhaltig verringern? Das Team rund um CarboFeed hat eine Lösung entwickelt, die CO2 als Rohstoffquelle nutzbar macht. Sie besteht aus einer neuartigen Hefe, die CO2 fixiert und in weiterer Folge als hochwertiger Futterzusatz für Nutztiere eingesetzt werden kann.
Der Rudolf Sallinger Fonds hat mit Michael Egermeier von CarboFeed gesprochen, um herauszufinden, wie sich die Geschäftsidee seit dem S&B Award 2019 weiterentwickelt hat:
Im vergangenen Jahr hat es CarboFeed unter die Top 10 des S&B Awards geschafft. Wie hat sich CarboFeed seither weiterentwickelt?
Michael Egermeier: Wir sind mit unserer Technologie zum damaligen Zeitpunkt noch sehr früh gewesen und momentan etwa bei der Halbzeit des FFG Spin-off Fellowships. Mit unserem Projekt bzw. der nötigen Technologieentwicklung liegen wir genau im Zeitplan.
In den letzten Monaten haben wir sehr viel positives Feedback erhalten – auch durch Artikel in verschiedensten Medien, wie zum Beispiel „Der Standard“ oder „Die Presse“. Des Weiteren ist es uns gelungen die wissenschaftlichen Grundlagen hinter der CarboFeed Technologie in dem renommierten Fachjournal Nature Biotechnology zu veröffentlichen. Das hat uns geholfen, viele gute Kontakte zu knüpfen – und die können wir gut brauchen, weil wir schon bald in die nächste Finanzierungsrunde starten werden.
Wie wird CarboFeed hergestellt?
CarboFeed wird in einem biotechnologischen Prozess in Bio-Reaktoren hergestellt. Man kann sich das vorstellen wie ein großer Kochtopf mit riesigem Fassungsvermögen, in dem verschiedene „Prozessparameter“ von außen kontrolliert werden können. In diesen Bio-Reaktoren wird Hefe in einem Nährmedium herangezüchtet, das funktioniert ähnlich wie bei der Herstellung von Bier- oder Bäckerhefe.
In welchen Bereichen ist CarboFeed einsetzbar?
Unser Ziel ist es, die Versorgung mit Protein nachhaltiger und regionaler zu machen. Haupteinsatz der proteinreichen CarboFeed Hefe sind Tierfutter.
Momenten werden in Europa rund 70 Prozent des Proteins, das wir verfüttern, in Form von Soja importiert. Das ist ein riesen Problem. Mit CarboFeed können wir proteinreiche Hefemasse statt Soja als Futtermittelzusatz verwenden. Sie kann sowohl in der Geflügel-, Schweine- und Rinderzucht als auch in Aquakulturen (Fischzucht) eingesetzt werden. Vor kurzem haben wir damit begonnen, den Markt für Haustier-Futtermittel zu bearbeiten, da hier ebenfalls ein großer Bedarf an Proteinen besteht – auch dieser Bereich ist für CarboFeed daher sehr interessant.
Gibt es schon Gespräche mit der Industrie?
Wir hatten schon sehr früh einen konkreten Ansprechpartner aus der Industrie, es handelt sich um einen Hersteller von Futtermittelzusatzstoffen. Mit diesem Partner stehen wir laufend im Austausch, die Gespräche laufen sehr gut.
In den letzten 9-12 Monaten sind außerdem noch ein paar weitere Firmen sowie ein Investor an uns herangetreten.
Was sind die größten Herausforderungen in der Weiterentwicklung von CarboFeed?
Es gibt einerseits technische Milestones, die wir erreichen müssen. Dazu zählen etwa Kennzahlen wie die Prozessgeschwindigkeit oder die Ausbeute, welche die wirtschaftliche Prozessführung des CarboFeed Prozesses zeigen.
Andererseits müssen wir uns intensiv um die Zulassung kümmern. Jedes Futtermittel muss durch ein Zulassungsverfahren, hier gibt es ganz klare Vorgaben. Aufgabe für die nächsten Monate wird also sein, viele Daten für unser Dossier zusammenzutragen und das Zulassungsverfahren schnellstmöglich in Gang zu setzen.
Welche unternehmerischen Ziele habt ihr euch für 2020 gesetzt?
Ob die Zulassung heuer schon starten kann, wird man erst sehen, da im Vorfeld noch viel Arbeit passieren muss. Abhängig von unserer nächsten Finanzierungsrunde werden wir außerdem unseren weiteren Pfad bezüglich einer Firmengründung gegen Ende 2020 abstimmen. Um hier noch mehr Details nennen zu können, ist es aber noch zu früh.
Welche Tipps könnt ihr Jungunternehmern (und allen, die es noch werden wollen) mit auf den Weg geben?
Es ist immer interessant mit Leuten zu sprechen, die direkt in der jeweiligen Branche verankert sind. Über sie kann man leichter an Kennzahlen, Marktzahlen, Produktspezifikationen etc. gelangen. Natürlich findet man auch viel im Internet, muss diese Informationen aber richtig herausfiltern – da sind Menschen, die an der Quelle sitzen, sehr hilfreich.
Wenn man sich aus dem geschützten Raum der Uni hinaus wagt und etwas in Gang setzt, kommt außerdem sehr viel auf einen zu – die Flut an Daten, Gesprächen und E-Mails ist sehr groß. Um das zu bewältigen, muss man einen guten Überblick behalten und strukturiert arbeiten.
Außerdem ist die Zusammensetzung des Teams von entscheidender Bedeutung, um ein universitäres Forschungsprojekt in ein funktionierendes Unternehmen zu verwandeln. Es geht um gegenseitige Motivation aber auch darum zu wissen wo man seine eigenen Stärken und Schwächen hat, um diese mit geeigneten Mitarbeitern oder Projektpartnern zu ergänzen.