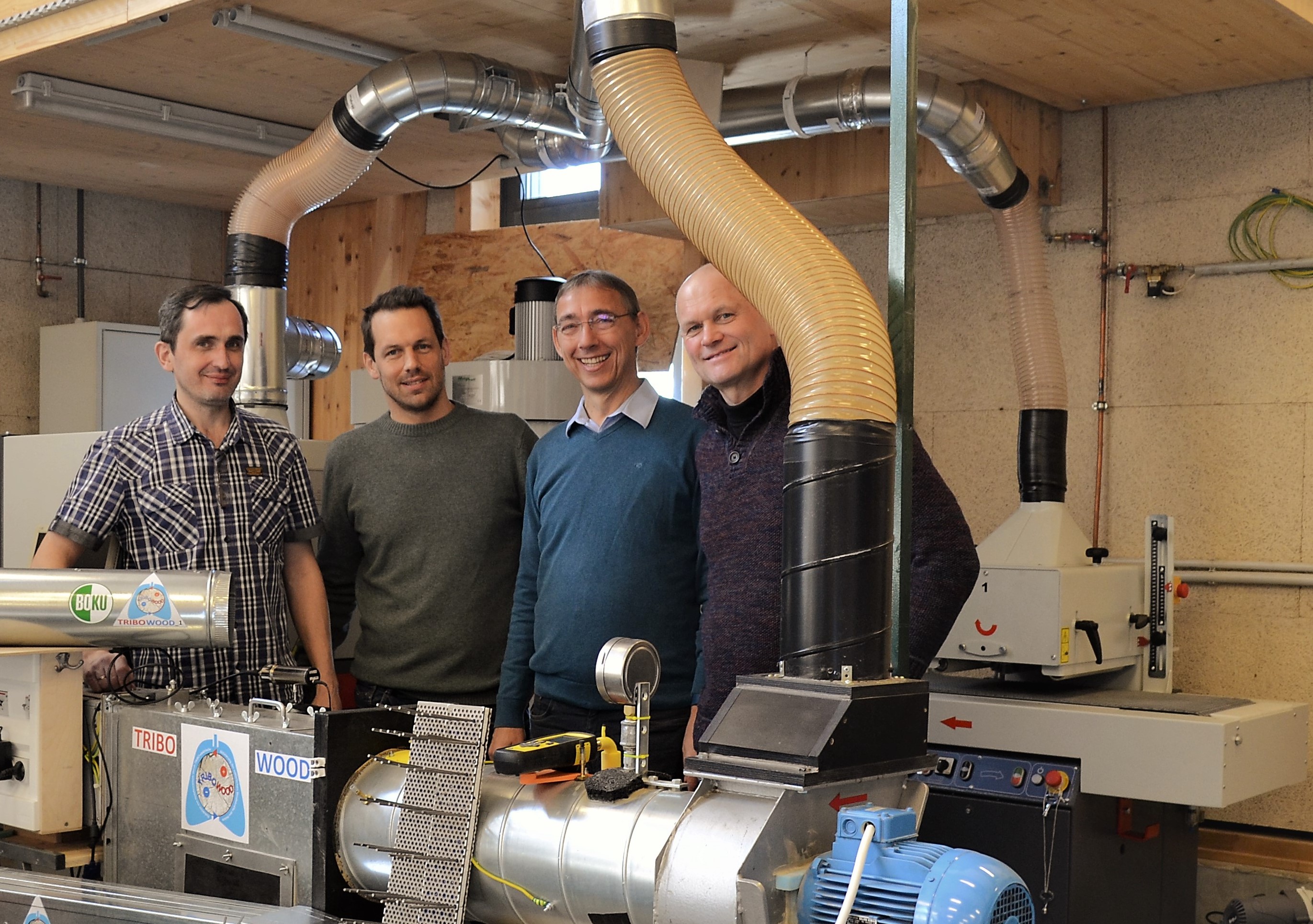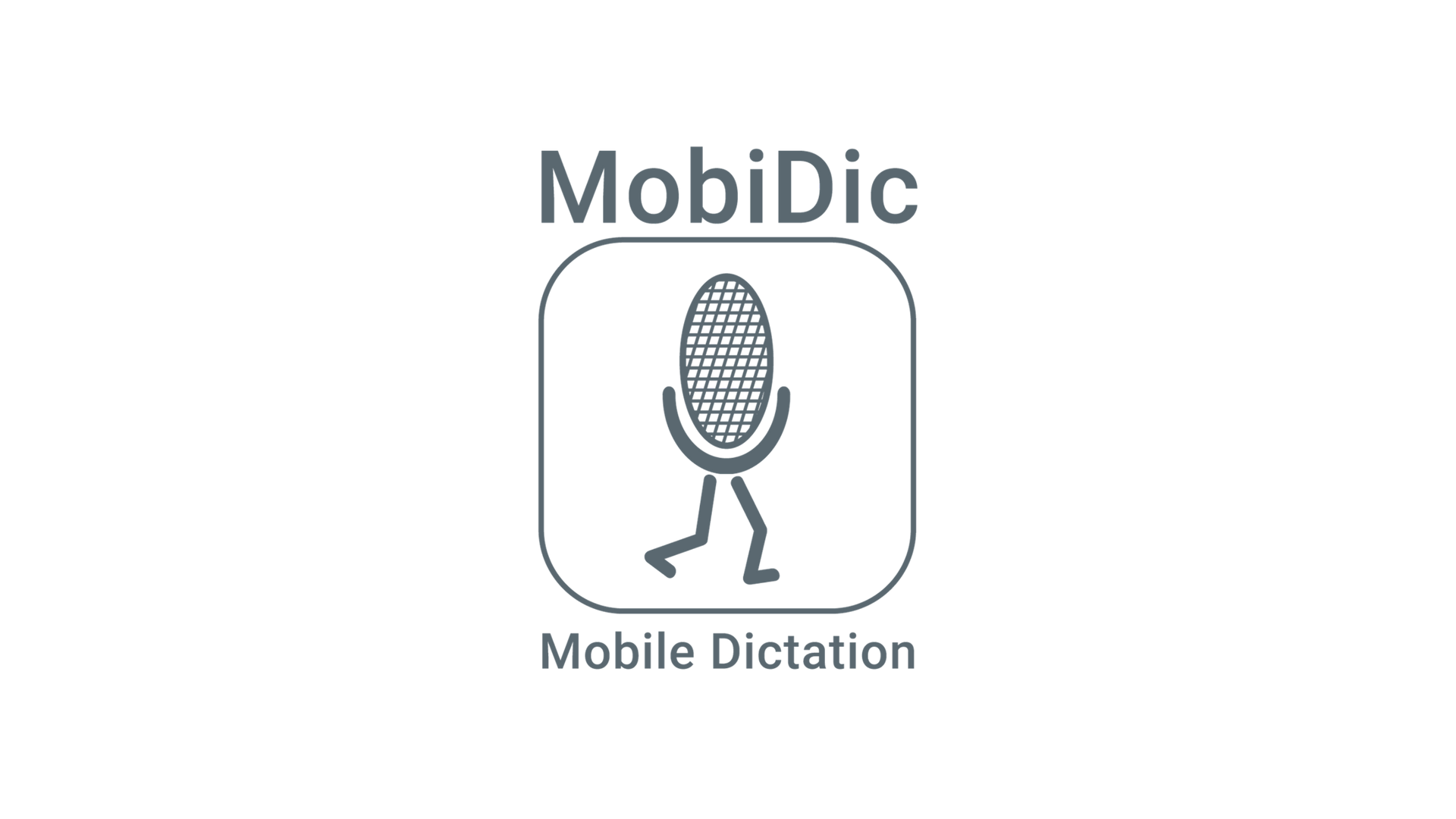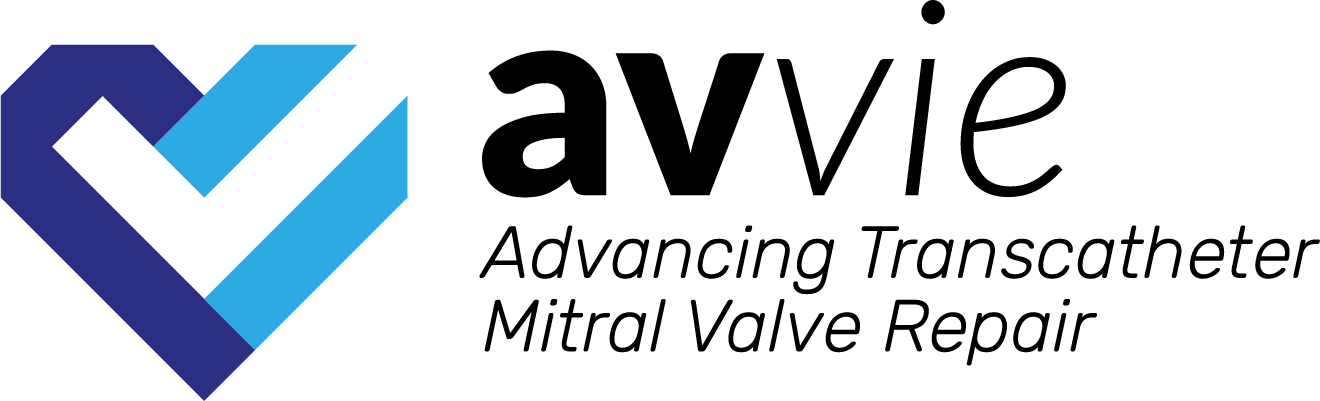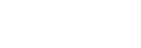Immer mehr junge Menschen fühlen sich nicht gut auf die Arbeitswelt vorbereitet. My Future Academy möchte genau das ändern. Sie hilft motivierten Menschen in interaktiven Workshops dabei, ihr volles Potenzial zu entfalten. Individualität und Interaktivität sind dank zahlreicher Praxisübungen und verschiedenster Gastsprecher in jedem Workshop garantiert.
Der Rudolf Sallinger Fonds führte mit Mitgründerin Sinem Günel ein Interview, in dem es um die Weiterentwicklungen, Ziele und Zukunft des ehemaligen Top 10 Finalisten der Future Founders Challenge 2018 ging:
Das Start-Up My Future Academy ist vor rund einem halben Jahr unter die Top 10 der Future Founders Challenge 2018 gekommen. Was hat sich seitdem getan?
Sinem Günel: In den letzten Monaten ist unser Start-up zu einem Verein geworden, weil diese Form am besten zu den Ansprüchen der My Future Academy passt. Wir haben unsere Vision auch nochmal geschärft, was dazu geführt hat, dass sich unser Team wieder ein wenig verkleinert hat.
Während der Future Founders Challenge haben wir uns vor allem an Schülern, aber auch Studierenden orientiert. Mittlerweile sind wir aber auch offener, was unsere Zielgruppe betrifft, um herauszufinden, wer den größten Benefit von einer Teilnahme bei My Future Academy hat.
Wie habt ihr euer Angebot seit dem Launch weiterentwickelt und warum?
Sinem Günel: Der Inhalt der My Future Academy ist grundsätzlich gleich geblieben. Was sich aber verändert hat, ist die Qualität der Workshops. Wir haben mittlerweile viel Erfahrung gesammelt und die Qualität deutlich gesteigert. Dank größerer Projekte haben wir extrem viel dazugelernt, was es bei einer Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern zu beachten gilt. Die wichtigsten Learnings waren mit Sicherheit, dass alles viel länger dauert, als man denkt und dass man von Anfang an ganz klar und strukturiert arbeiten muss. Unsere Workshops sollen für Teilnehmer weiterhin kostenlos bleiben, wir haben daher auch gelernt, Klarheit darüber zu schaffen, was unsere Kooperationspartner für den Erfolg der Workshops tun können – gerade sie sind es nämlich, die über für die Workshops wichtige Ressourcen verfügen.
Ihr habt bereits über die „Hands on Challenges“ gesprochen, die in eure Workshops eine wichtige Rolle spielen. Wie sehen diese Challenges aus und warum sind diese so zentral?
Sinem Günel: Unsere „Hands on Challenges“ binden die Teilnehmer aktiv in unsere Workshops ein. Reine Vorträge tragen nicht viel zum Lernen bei – das sehen wir in unseren Workshops und hören es auch immer wieder als Feedback. Wir wollen daher, dass unsere Teilnehmer ein aktiver Teil jedes Workshops sind. Wir liefern kurze theoretische Inputs zu einem bestimmten Thema, im Anschluss wird dieses Wissen dann praktisch umgesetzt.
Eine beliebte Challenge ist die „Marshmallow Challenge“. Dabei müssen die Teilnehmer im Team aus verschiedenen Materialien wie Spaghetti, einer Schnur und Krepp-Band einen Turm bauen, an dessen Spitze ein Marshmallow sitzt. Das Team mit dem höchsten freistehenden Turm gewinnt die Challenge. Bei dieser Challenge geht es viel um die Dynamiken des Teams – wie hat das Team zusammengearbeitet, wie wurden Entscheidungen getroffen etc.
Eine andere Challenge betrifft das Zeitmanagement. Die Teilnehmer erhalten von uns einen A4 Zettel mit 168 Kästchen, die für alle Stunden einer Woche stehen. Dann malen die Teilnehmer jene Kästchen aus, die sie bewusst für verschiedenste Dinge verwenden – dazu zählen unter anderem Arbeit, Schlafen und Essen. Bei jedem Teilnehmer bleiben einige Kästchen weiß – das sind jene Stunden, die sehr oft auf die Handynutzung entfallen. Diese Challenge führt also vor Augen, wie viel Zeit wir „unnötig“ verschwenden und wie viel effizienter wir mit dem richtigen Zeitmanagement sein könnten.
Egal, um welche Challenges es sich handelt – das Schöne ist, dass die Teilnehmer immer voneinander profitieren können.
In welcher Zielgruppe kommt die My Future Academy am besten an?
Sinem Günel: Im Kern unserer Zielgruppe sind sicherlich Studenten. Wir haben aber auch viele bereits Berufstätige, die unsere Workshops besuchen. Die am schwierigsten zu erreichende Zielgruppe sind Schüler – wenn sie aber einmal bei uns waren, sind sie genauso begeisterungsfähig wie alle anderen. Der bunte Mix der Gruppen macht jeden Workshop für uns so besonders.
Welches Feedback geben euch die TeilnehmerInnen der Workshops?
Sinem Günel: Wir erhalten durchwegs positives Feedback nach unseren Workshops. Die Teilnehmer schätzen, dass unsere Workshops interaktiv sind. Viele wollen am Ende eines Workshops schon wissen, wann der nächste stattfindet.
My Future Academy bietet den nötigen Rahmen, damit unterschiedlichste Menschen voneinander lernen können. Die Teilnehmer verlassen unsere Workshops also nicht nur mit neuem Wissen, sondern auch mit dem guten Gefühl, anderen mit ihrem Wissen geholfen und etwas zu einem großen Ganzen beigetragen zu haben.
Was habt ihr euch für 2019 vorgenommen?
Sinem Günel: Wir möchten in diesem Jahr noch viele weitere Workshops anbieten, um unsere Zielgruppe näher kennenzulernen und herauszufinden, was genau die Teilnehmer unserer Workshops möchten, brauchen und erwarten.
Parallel dazu planen wir, größere Programme vorzubereiten, innerhalb derer wir eine Gruppe von Menschen auf regelmäßiger Basis treffen, um immer wieder und intensiv gemeinsam an bestimmten Themen zu arbeiten.